21. Europäischer Gesundheitskongress München am 6. und 7. Oktober 2022

Den Wandel in die Hand nehmen: Mehr wagen! Wieder über 800 Teilnehmer.
Als „coming home“ haben die über 800 Teilnehmer den Europäischen Gesundheitskongress München erlebt. Endlich wieder ein persönlicher Austausch untereinander sowie lebhafte und kontroverse Diskussionen auf dem Podium. Zudem war eine kraftvolle Aufbruchstimmung auf dem 21. Europäischen Gesundheitskongress München zu spüren. Das Gesundheitssystem stehe vor gewaltigen Herausforderungen. Unbestritten. Aber genug analysiert, genug gejammert. „Wir brauchen nicht nur eine Energiewende, sondern auch eine "Gesundheitswende“, so Kongressleiterin Claudia Küng, und forderte einen offenen Diskurs darüber, was die Gesellschaft an Gesundheitsleistungen in den nächsten Jahren brauche und zu finanzieren bereit sei.
Das Kongressmotto „Mehr wagen statt klagen – die unterschätzten Möglichkeiten im Gesundheitswesen“ nahm der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek gerne auf: „Das ist das, was wir brauchen: Zuversicht und Mut! Wir stehen vor einer entscheidenden Wende, so Holetschek. Neue Ideen seien gefragt, bei der Digitalisierung und vor allem bei der Pflege: Die Arbeitsbedingungen gehören verändert. Die Gesundheitsbranche sieht er nach wie vor als eine Leitökonomie der Zukunft. „Aber wir müssen den Wandel selbst in die Hand nehmen. In Berlin wird zu lange diskutiert. Der Staat muss schnell entscheiden, etwa wie Pflegeeinrichtungen die aktuellen Energiekosten stemmen sollen.“
Das Thema Gerechtigkeit auch gegenüber der jungen Generation, hat der Volkswirtschaftler Christian Hagist mit erheblichem Zündstoff untermauert. Er will weg von der Vollkasko-Mentalität. Schon jetzt sei die GKV mit Milliarden unterfinanziert. „Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, werden Beitragszahler ab 2030 an die 50 Prozent allein für die soziale Sicherung abführen müssen.“ Eine illusorische Perspektive. Aber wie die klammen Kassen füllen? Hagist: „Ohne Kürzungen wird es nicht gehen. Wer z.B. eine Zweitmeinung will, soll sie selbst zahlen.“ Er plädiert für weniger Staat und mehr Eigenverantwortung und marktwirtschaftliches Denken. „Wenn sich eine Klinik nicht mehr rechnet, dann muss sie schließen.“ Und der Einzelne müsse mehr für seine Absicherung tun. Bis etwa 2035 gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, was u.a. Mehrausgaben für die Gesundheit mit sich bringt. So radikal will das Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit, nicht stehen lassen. Beispiel Krankenhaus-Struktur: „Hier müssen alle Teilnehmer an einem Strang ziehen. Die Krankenhaus-Reform muss Chefsache des Bundeskanzlers werden. Wir brauchen keine 100 Milliarden € Sondervermögen wie für die Bundeswehr, es würden schon 40 bis 50 Milliarden reichen.“ Was also gilt es neu zu wagen, um an das Motto des Kongresses zu erinnern? „Eine Wende im Denken. Die Menschen müssen überzeugt werden, dass nicht die Anzahl der Kliniken relevant ist, sondern die Qualität der Behandlung und dass man dafür auch einige Kilometer mehr fahren muss als bisher.“ Die Holländer praktizieren das längst.
Mega-Thema auf dem Kongress: Wie die Finanzen in der Pflege regeln? Privat oder öffentlich? Eine Grundsatzfrage. Fakt ist, es gibt deutschlandweit drei Millionen Pflegebedürftige, davon werden zwei Drittel daheim versorgt. Noch, denn die Zeiten, in denen vor allem Frauen das übernommen haben, sind vorbei. Bei Doppelverdienern bleiben dafür keine Kraft und Zeit mehr. Aber es gibt zu wenige stationäre Plätze. Allein in Bayern sind 15 Prozent nicht vergeben, weil es kein Personal gibt. Die Menschen helfen sich anders: Prof. Thomas Klie vom Institut AGP Sozialforschung: „Wir haben 850.000 ausländische Haushaltshilfen. Das ist schlicht ein System-Versagen.“ Und er sieht noch einen Knackpunkt: Heimpflege werden sich bald nur noch die Wohlhabenderen leisten können. Die alternde Gesellschaft mit einem steigenden Pflegebedarf gilt unbestritten als treibender Wirtschaftszweig. Viele Experten sind sich sicher: Ohne privates Investment wird es nicht funktionieren. Thomas Kupczik betreibt die zweitgrößte Pflegeheimgruppe Deutschlands. Seine Alloheim Senioren-Residenzen SE beschäftigt an 160 Standorten 22.000 Mitarbeitende. Er rechnet vor: „Bis zum Jahr 2040 haben wir 4,2 Millionen Pflegebedürftige. Die Kosten werden um das Zweieinhalbfache steigen. Denn es kommen nicht die rüstigen Rentner ins Heim, sondern vor allem Menschen mit einem hohen Pflegegrad.“ Er will das System als solches nicht infrage stellen - kommunal oder privat. „Es muss beides geben.“ Aber der private Sektor werde zunehmen müssen. Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, sieht es etwas anders: „Daseinsvorsorge gehört in kommunale Hand. Aber wir können das nicht alleine schaffen. Wir schaffen es nur gemeinsam.“ Klar sei, dass auch kommunale Häuser wirtschaftlich arbeiten müssten, um reinvestieren zu können. Mehr wagen heißt also im Pflegesektor: Das Denken von einerseits privat und anderseits kommunal ist überholt, es geht nur zusammen.
1. Was die Pandemie gelehrt hat
Beispiel Pandemie. Im dritten Jahr von Corona und wieder steigenden Inzidenzen, was haben ExpertInnen aus den vergangenen Jahren gelernt? Eine ganze Menge, wie der Kölner Intensivmediziner Prof. Christian Karagiannidis ausgeführt hat. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin ist Mitglied der Kommission, die momentan für die Bundesregierung die Krankenhausstrukturen überarbeitet.
„Es war gut, von Anfang an transparent zu kommunizieren, Daten zu veröffentlichen und nötige Schritte, wie Kontaktbeschränkungen, zu erklären.“ Kliniken, die sonst im Wettbewerb zueinanderstehen, haben zusammengearbeitet.“ Alle haben an einem Strang gezogen. Alles bestens also? Mitnichten. Die Pandemie machte einmal mehr klar, wo es hakt. Die Zahl der Intensiv-Betten etwa ist eben nur eine Zahl und sagt nichts darüber aus, wie viele Patienten eine Klinik tatsächlich behandeln kann. Denn ein Bett kann nur belegt werden, wenn es Pflegende gibt, die sich darum kümmern. War man vor der Pandemie von 30 Intensivbetten pro hunderttausend Einwohnern ausgegangen, weiß man inzwischen, es sind nur zehn. Karagiannidis: „Das reicht aktuell aus. Noch, denn viele Pflegekräfte gehören zu den Babyboomern, die bereits jetzt oder in den nächsten Jahren in Rente gehen“. Das trifft das Gesundheitssystem doppelt: Noch mehr Ältere, die medizinische Hilfe brauchen, und gleichzeitig weniger Pflegende. Momentan sind bereits 80 Prozent aller Klinikbetten belegt. Für die restlichen fehlt das Personal. Die Folge: schon jetzt stellen Kliniken die Ampeln oft genug auf rot, weil sie keine Notfälle aufnehmen können.
Der demografische Wandel hat noch eine weitere gravierende Folge: weniger Beitragszahler bedeuten weniger Geld. Die Lösung aus seiner Sicht: „Weg vom Bashing der kleinen Kliniken. Diese Idee wird vielen nicht gefallen. Aber jetzt ist die Zeit für mutige Entscheidungen. Kliniken schließen und nur noch mit rund 600 weiterarbeiten? Das mag für spezielle Bereiche genügen – eine Pandemie und die Tumorchirurgie etwa.“ Aber was tun mit Menschen, die „Rücken haben“ oder chronisch krank sind? Gerade auf dem Land gibt es immer weniger niedergelassene Ärzte. Hier gelte es, das Potential kleiner Häuser zu nutzen, allerdings anders als bisher. „Wir brauchen weniger stationäre Strukturen und mehr ambulante Angebote. Und nicht zu vergessen sei, dass Kliniken auch wichtige Ausbildungsstätten sind.
Szenenwechsel nach Dänemark. Ein kleines Land mit knapp sechs Millionen Einwohnern, die mehrheitlich gut durch die Pandemie gekommen sind. Senior Advisor Ole Thomsen: „Obwohl wir für eine Pandemie nicht gewappnet waren und umgerechnet viel weniger Klinken als in Deutschland haben. Gute Vernetzung unserer fünf Gesundheitsregionen war entscheidend und wir Dänen vertrauen unseren staatlichen Institutionen.“ Die Impfbereitschaft war dementsprechend hoch und Dinge wie Kontaktbeschränkungen und Homeoffice wurden sofort konsequent befolgt. Thomsen: „Die Akutsituation haben wir gut bewältigt, aber die Folgen spüren wir jetzt. Pflegende verlassen zunehmend den öffentlichen Dienst und wechseln zu privaten Einrichtungen, die besser bezahlen.“
Spannend auch die Erfahrungen aus Italien, dem Land mit den meisten Covid-Toten – über 170.000! Dr. Florian Zerzer, Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs, „Wir wurden zum Vorreiter für ganz Italien. Wir fingen bei Null an, die Südtiroler Regierung hatte keine Strategie. Wir haben schnell auf Tests gesetzt und große Zelte vor die Kliniken aufgestellt.“ Auch mit den Impfungen lief es gut. Die Südtiroler seien eher Impf-Muffel, aber die vielen Toten und die Impfstrategie haben das geändert. Entscheidend aber auch das: „Wir sind zu den Menschen gegangen - mit Impfbussen, die über die Dörfer gefahren sind, und wir haben für die Jungen Impfpartys gemacht.“ Bald waren 84 Prozent der Bevölkerung in der Region geimpft. Trotzdem sieht er Defizite in Richtung Brüssel: Bei Ereignissen wie einer Pandemie müsse es eine zentrale Koordinierung durch die EU geben.
2. Effizientere Krankenhausstrukturen
Effizienter heißt, Sektoren überwinden. Nicht jedes Kreiskrankenhaus soll wie bisher möglichst viele Bereiche abdecken. Im Gegenteil, Betten sollen abgebaut und ambulante Dienste aufgebaut werden. Der Kölner Intensivmediziner Christian Karagiannidis ist überzeugt: „Wichtig ist, das medizinische Personal an den jeweiligen Standorten zu halten: Die Leute ziehen nicht x-beliebig weit mit. Einen längeren Arbeitsweg als 20 Kilometer akzeptieren die meisten nicht. Dasselbe gilt für die bisherigen Arbeitszeiten.“ Die müssten flexibler werden, es brauche mehr Teilzeitangebote – für ärztliches wie pflegendes Personal. Und es brauche mehr Ehrlichkeit gegenüber Patienten, die sich auf Einschränkungen einstellen müssten.
Welche Blüten das Anspruchsdenken treiben kann, zeigen unter anderem die Erfahrungen im Rettungswesen. Ein Notarzt ist - wie es der Name sagt – zuständig für lebensbedrohliche Notfälle. Längst aber rücken Rettungskräfte wegen vergleichsweiser harmloser Verletzungen oder Beschwerden aus. Allein in der Zeit von 2010 bis 2019 stiegen bayernweit die sogenannten Notfallereignisse um 44 Prozent an. Tatsächlich aber fuhr jeder dritte Rettungswagen unverrichteter Dinge wieder zurück, weil gar kein Notfall vorlag. Und das vor dem Hintergrund, dass inzwischen Notärztinnen und Notärzte händeringend gesucht werden. „Es wird immer schwieriger, entsprechende Stellen in den Kliniken zu besetzen, es fehlt am Nachwuchs“, so PD Dr. Stephan Prückner, Geschäftsführender Direktor am Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Uni München. Sein Lösungsvorschlag: „Schon im Vorfeld sondieren, welche Art von Hilfe nötig ist. Dazu braucht es qualifiziertes medizinisches Personal. Heißt, einen Teil der momentan 26 Leitstellen in Bayern abbauen, dafür aber die verbleibenden professionell besetzen.“ Das würde Druck aus dem System rausnehmen.
Egal wie sie heißen - Integrierte Versorgungszentren oder Regionale Gesundheitszentren etwa, die Richtung ist klar: die Allgemeinversorgung bleibt lokal verankert, Spezialbehandlungen, wie eine Hüft-OP, gehören in spezialisierte Zentren. Kleine Krankenhäuser sollen zum Zentrum für diverse Heilberufe werden - in der Pharmazie, in der Logo- und Ergotherapie, einschließlich Haus- und FachärztInnen. Schließlich soll die Klinik selbst ambulante Dienste anbieten. Das bedingt allerdings eine neue Art der Finanzierung. Die bisherige stationäre Versorgung geriet zum Fass ohne Boden. „Seit 2005 haben wir eine Kostensteigerung von 73 Prozent“, so Dr. Ralf Langejürgen vom Verband der Ersatzkassen, Landesvertretung Bayern. Das Zauberwort der hybriden DRGs muss aber erst noch gesetzlich geregelt werden. Im Koalitionsvertrag sind sie bereits erwähnt. Bleibt die Frage, wie schnell das die Politik realisiert.
Als Leit-Kongress für die DACH-Region Deutschland - Österreich - Schweiz liegt der Fokus beim Europäischen Gesundheitskongress München immer mit auf internationalen Erfahrungen. Nicht nur im Denken also Grenzen überwinden. Beispiel Italien. Dr. Thomas Schael, Generaldirektor, Sanitätsbetrieb ASL2, Lanciano Vasto, Provonz Chieti: „Regionale Versorgungszentren sind auch bei uns das Ziel. In Italien wurden 200 Kliniken geschlossen, beziehungsweise werden in solche Zentren umgewandelt.“ Die Weichen dazu hatte noch Mario Draghi gestellt. Als Technokrat rettete er den Euro und als Regierungschef ging er genauso rigoros das Gesundheitssystem an und machte dafür 200 Millionen Euro EU-Gelder locker. Das Ziel: Bis 2027 sollen ein System entstehen, das auf drei Säulen basiert. Schael: “Geplant sind 1.300 solcher Gesundheitszentren. Dort bieten Fachärzte und Pflegende ihre Leistungen an. Daneben soll es 400 Gemeinschafts-Krankenhäuser geben und 600 Koordinierungszentren.“ Letztere sind Ansprechpartner für niedergelassene Ärzte und haben eine Lenkungs- und Filterfunktion. Sie machen zum Beispiel Termine beim Facharzt aus und sollen die Notaufnahmen entlasten. Schael: „Das Ziel ist klar, wie wollen weniger stationäre Strukturen und das Vertrauen der Menschen in die lokale Versorgung stärken.“ Ein ehrgeiziges Ziel, das in fünf Jahren realisiert werden soll.
3. Leuchtturmprojekte in der Pflege
Auf Pflege angewiesen sein, das kann jeden in jedem Alter treffen. Umso erstaunlicher ist es, dass Jahre ins Land gehen, ohne dass sich wesentlich etwas verbessert. Modelle, die beispielhaft vorangehen, wurden auf dem 21. Europäischen Gesundheitskongress München vorgestellt.
Zu Pflegende brauchen wie alle Menschen Anregungen, das Gefühl, das sie etwas Nützliches tun können, Aktivieren statt Passivität. Kaspar Pfister, Geschäftsführender Gesellschafter der Benevit-Holding GmbH hat das längt realisiert. Die Bewohner helfen mit beim Kochen oder Aufräumen bis zum Dekorieren des Heims. Das Zusammenleben erinnert eher an WGs als an eine Pflegeeinrichtung. Pfister spricht von „stambulant“ – die Verknüpfung von stationär und ambulant. Denn in den stationären BeneVit-Hausgemeinschaften sind ambulante Elemente unverzichtbar und werden teils sogar von den Angehörigen geleistet, wenn sie das möchten. Trotzdem gibt es rund um die Uhr Fachkräfte, die zur Stelle sind, wenn es nötig ist. Das alles funktioniert seit Jahren bestens, ist mehrfach wissenschaftlich begleitet und für gut befunden worden, auch von politischer Seite. Trotzdem leuchtet dieses Leuchtturmprojekt noch immer nicht in der Regelversorgung. Der Münchner Pflege-Experte Claus Fussek schüttelt da nur den Kopf: „Ich kann einfach nicht verstehen, warum vorbildliche Projekte nicht flächendeckend vorangetrieben werden.“
Wenn Mensch und Tier zusammenleben
Aus eigener Betroffenheit heraus hat der westfälische Landwirt Guido Pusch eine geniale Idee entwickelt – die des Pflegebauernhofs. Ursprünglich ging es um die Großmutter und später um den krebskranken Vater, die die Familie adäquat versorgt wissen wollten. Auch hier der Ansatz: Alte Menschen im Alltag integrieren, ihnen nicht alles abnehmen, sondern sie anspornen. Aus der Idee sind inzwischen drei Wohngemeinschaften auf dem Hof geworden. Pflegerischen Leistungen sind möglich, aber elementar ist das Miteinander und die Mithilfe im Alltag und sei es nur das Aufsammeln der Eier im Hühnerstall. Und auch das Wohlfühlen stimmt, allein durch das Beobachten von Schweinen, Gänsen und Alpakas.
Wie sich das außer der mitmenschlichen Komponente rechnet? Guido Pusch: „Jeder Bewohner bezahlt Miete und eine Lebensmittelpauschale. Daneben gibt es eine Betreuungspauschale, die jeder mit einem ambulanten Pflegedienst je nach Pflegegrad über die Pflegeversicherung selbst abrechnet.“ Er nennt sich selbst „eine kleine Erbse im System Pflege“. Aber eine mit Strahlkraft, inzwischen bekommt er Anfragen aus ganz Deutschland, selbst eine Delegation aus Japan hat schon bei ihm vorbeigeschaut. Mittlerweile berät er interessierte Landwirte, die ebenfalls einen Pflegebauernhof planen.
Er kann sich sogar vorstellen, dass ein Hof ein Ausbildungsort für Pflegekräfte werden kann. Heuer ist er mit dem Deutschen Demografiepreis ausgezeichnet worden. Begründung der Jury: „Uns hat die Verbindung von zwei Branchen fasziniert, die beide große Probleme haben: Wir brauchen Pflegekräfte, und viele landwirtschaftliche Betriebe stehen vor dem Aus, weil die Nachfolge fehlt. Beides unter dem Demografieaspekt zusammenzubringen, hat uns überzeugt.“
Kongresspräsident Professor Karl Einhäupl, der wissenschaftliche Leiter Professor Günter Neubauer und die Kongressleiterin Claudia Küng freuen sich nach diesen erfolgreichen zwei Tagen in 2023 weiterzumachen: Der nächste Europäische Gesundheitskongress München findet am 26. und 27. Oktober 2023 wieder München im Hilton Park statt.
Notieren Sie sich den Termin oder buchen Sie schon jetzt Ihr Ticket zum Frühbuchertarif!
Herzlichst

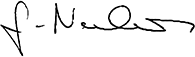
Ihr Prof. Dr. Günter Neubauer
Direktor, Institut für Gesundheitsökonomik


Ihre Claudia Küng
Kongressleiterin & Geschäftsführerin
WISO S.E. Consulting GmbH
Der gesundheitspolitische Kongress fand im Herbst 2022 hybrid mit einer Teilnahmemöglichkeit vor Ort und digital statt.
Weitere Fotos des 21. Europäische Gesundheitskongress finden Sie hier.









